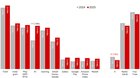Unter dem ehemaligen Chefredaktor Roger Köppel, das ist allgemein bekannt, legte die «Weltwoche» erst massiv zu, dann verlor sie aber wieder Auflage. Nach der Umstellung vom Zeitungs- aufs Zeitschriftenformat war die Auflage des Blattes nach 2001 von rund 84 000 auf 91 000 Exemplare gestiegen. Danach war sie wieder gesunken, und zwar wegen des «ausgeprägt rechtsbürgerlichen Kurses», mit dem der als kreatives Wunderkind unter den Chefredaktoren gelobte Köppel seinen eigenen Erfolg innert kurzer Zeit zunichte gemacht habe, wie die «NZZ am Sonntag» (NZZaS) weiss. Nicht nur Leser hätten sich zu Tausenden abgewandt, sondern auch auf der Redaktion sei der Unmut über den zunehmend radikalen Chef gewachsen. Renommierte Journalisten wie Martin Beglinger, Markus Schneider, Margrit Sprecher und Martin Suter hätten das Magazin verlassen.
Die NZZaS nennt auch Zahlen: Der «rückläufige Trend», von dem die damalige Verlagsleiterin Uli Rubner 2004 gesprochen hatte, stelle sich heute als regelrechter Einbruch heraus. NZZaS-Quellen sprechen von einem «Rückgang vom Herbst 2003 auf Sommer 2004 um rund 12 000 Exemplare». Dieser Einbruch, der gemäss NZZaS im Herbst 2005 in den Zahlen der AG für Werbemedienforschung Wemf abgebildet sein wird, «bleibt wohl an seinem Nachfolger Simon Heusser hängen», der seit Köppels Abgang zur deutschen «Welt» im Mai 2004 der «Weltwoche» vorsteht. Seit fünf Monaten steigt gemäss Heusser jedoch die «Weltwoche»-Auflage wieder.
Jean-Frey-CEO Filippo Leutenegger verneint gegenüber der NZZaS den Auflageneinbruch von 12 000 Exemplaren - und Roger Köppel schreibt gemäss der NZZaS, dass ihm «diese Zahlen» nicht bekannt seien, der Verlag habe damals anders kommuniziert; wichtig seien die «positive Auflage-Entwicklung nach Fredy Gsteiger (seinem Vorgänger als Weltwoche-Chef) sowie der operative Gewinn nach Jahren der Millionenverluste» gewesen.
Sonntag
13.02.2005