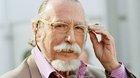Mit der Diskrepanz zwischen der bestehenden Rechtsordnung einerseits und der galoppierenden Entwicklung im personalisierenden Journalismus sowie der (Selbst-)Vermarktung von Prominenten anderseits befasste sich das Schweizer Forum für Kommunikationsrecht an einer Tagung vom Donnerstag unter dem Titel «Vermarktung von Persönlichkeiten».
Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Zürcher Rechtsanwalt Andreas Meili, der zum rechtlichen Rahmen in der Schweiz referierte. Zuerst hielt Meili fest, dass die Vermarktung der Persönlichkeit in der Werbung und durch die Medien Teil der modernen Wirtschaft und der Rechtswirklichkeit sei. Prominenz und Pseudo-Prominenz seien omnipräsent und würden crossmedial vermarktet. Dies führe unter anderem auch dazu, dass sich viele Künstler- und andere Agenturen auf die professionelle Vermarktung von Personen und Persönlichkeitsrechten spezialisiert haben.
Prominente gehen Vermarktungsverträge mit bestimmten Kunden ein und lassen sich für die Benutzung ihrer Rechte Lizenzgebühren bezahlen. Diese Gebühren zeigen laut Meili, dass dem Vermarktungspotenzial von Persönlichkeitsrechten ein erheblicher wirtschaftlicher Wert zukomme. Der Mensch werde zur Marke und die Prominenz zum Eigentum. Der wirtschaftliche Wert ist laut Meili direkt davon abhängig, dass Vermarktungsmöglichkeiten kontrolliert und kanalisiert werden können, beispielsweise durch Exklusiv-Vermarktungsverträge, welche dann als Lizenzverträge bezeichnet werden. Die neuere Schweizer Rechtslehre lässt schuldrechtliche Gestattungsverträge (Lizenzverträge) zu, womit der Träger der Persönlichkeitsrechte Dritten die Nutzung seiner Identitätsmerkmale, in der Regel gegen Geld, gestatten kann. Als besondere Form nannte Andreas Meili in seinem Referat die so genannten Merchandising-Verträge als typische Vertragsformen in der Film-, Medien- und Musikindustrie. Hierbei betragen die Lizenzgebühren üblicherweise 7 bis 15% des Nettohändlerabgabepreises.
Hier komme dann auch der Rechtsschutz ins Spiel, denn ohne diesen könne gar kein wirtschaftlicher Wert für eine vermarktete Person erzielt werden. Das Problem dabei sei, dass die Vermarktung die Grenze zwischen dem geschützten Bereich einer Person und dem öffentlichen, grundsätzlich nicht gewünschten Bereich verwische. Die Kommerzialisierung der Persönlichkeitsrechte führe also zu einer «Veröffentlichung» oder «Verallgemeinerung» dieser Rechte. Hier steht man laut Meili vor einem Dilemma: Die Vermarktung funktioniere nur, wenn Persönlichkeitsrechte wirksam geschützt werden können. Diese Rechte würden aber gerade durch die Kommerzialisierung dem Schutzbereich der Intim- oder Privatsphäre entzogen oder aufgeweicht. Hierbei gelte die Faustregel: Je bekannter eine Person ist, desto eher muss sie sich Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte gefallen lassen.
Sonntag
05.04.2009